
Neue Wälder für das Land
Holz ist ein „Must-Have“
Auch wenn der Klimawandel unsere Wälder verändert: Holz bleibt ein wertvoller, nachwachsender Rohstoff mit großem Potenzial für die Energiewende. Prof. Dr. Bastian Kaiser von der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg erklärt, unter welchen Bedingungen die Nutzung von Brennholz ökologisch sinnvoll ist, warum regionale Ressourcen wichtig bleiben und wie der Wald von morgen aussehen kann.
In der Gesellschaft wird viel über die energetische Nutzung von Holz diskutiert. Wie wichtig ist Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft für den Beitrag zur Energiewende?
Bastian Kaiser: Die Energiewende hat mehrere Säulen: 1. Die Versorgung unserer Gesellschaft und der Wirtschaft mit Strom als zentrale Prozessenergie. 2. Die Verkehrswende und 3. Die Wärmewende. Sehr lange lag das Augenmerk der Umwelt- und Energiepolitik auf der Sicherstellung der Stromversorgung und auf der der Verkehrswende, bei der es zum Beispiel um die Förderung von Elektroautos, um die Verbesserung der Ladeinfrastruktur und um die Elektrifizierung des öffentlichen Personenverkehrs ging. Im Fokus standen bei diesen Überlegungen vor allem die Fotovoltaik und die Windkraft – und damit auch die zwangsläufigen Probleme einer hinreichenden Netzinfrastruktur. Die Wärmewende fand geradezu im stillen Kämmerchen statt und war allenfalls ein Thema für Expertinnen und Experten. Erst durch Putins völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde den Menschen bewusst, dass auch die Wärmeversorgung auf eine andere Grundlage gestellt werden muss. Öl von arabischen Despoten oder lateinamerikanischen Autokraten, Kohle, Kohlestaub und Gas aus Russland, Energietransporte über immer gefährlicher und unzuverlässiger werdende Transportwege, gefährliche und gefährdete Lieferketten, technisch riskante Aufbereitungs- und Umwandlungsprozesse zur Energiebereitstellung sowie politisch nicht länger hinnehmbare Abhängigkeiten von energieexportierenden Ländern lenkten (endlich!) auch die Blicke von Politik und Gesellschaft auf den Wärmesektor. Die Angst vor einem kalten Winter und einer nicht ausreichenden, nationalen Gasreserve war ganz real, weit verbreitet und nicht unbegründet.
Erst jetzt wurde vielen klar, dass heimisches Holz – also ein technisch beherrschbarer, risikoloser und politisch unbedenklicher, permanent nachwachsender, heimischer Energieträger im Wärmemarkt schon mehr als 50 Prozent des Beitrags der erneuerbaren Energien leistete – dass die Expertinnen und Experten in ihrem stillen Kämmerchen ganze Arbeit geleistet, die Holzfeuerung moderner, emissionsärmer, effizienter, Öfen immer ästhetischer und Feuerungsanlagen immer wirtschaftlicher gemacht haben. Ohne das Holz aus unserer heimischen und nachgewiesen nachhaltigen Forstwirtschaft wäre es im Winter 2022/2023 in unseren Wohnstube kälter gewesen, könnten wir den aus meiner Sicht wirtschaftlich, technisch, politisch und ethisch richtigen Verzicht auf zweifelhafte Importe fossiler Energien nicht kompensieren und würde die Energiewende insgesamt nicht gelingen.
Ist es aus Ihrer Sicht vertretbar, Holz zur Wärmegewinnung zu nutzen? Und wenn ja: Unter welchen Bedingungen ist es realistisch, Feuerstätten langfristig mit Holz aus deutschen Wäldern zu betreiben?
BK: Ja, das ist vertretbar! Die Klarheit und Deutlichkeit dieser Aussage hat mit den Risiken anderer Energieträger, deren Umwandlung, dem Transport und der Nutzung zu tun, die ich eben erwähnt und die wir alle Jahrzehnte lang unkritisch in Kauf genommen haben. Vermutlich, weil wir der Kohle im Nachkriegsdeutschland und dem Erdöl seit den 6oer Jahren einen Großteil unseres Wohlstandes zu verdanken haben und weil diese Energie billig war. Heute wissen wir längst: Sie war zu billig, weil die Risiken nicht eingepreist wurden.
Hinzu kommt, dass die fossilen Energieträger nicht vermehrbar sind. Holz ist vermehrbar. Es wächst quasi hinter unseren Häusern, ist ein Energieträger der ganz kurzen Wege, ohne politische und technische Risiken. Das stimmt so aber nur dann uneingeschränkt, wenn wir Holz aus nachgewiesen nachhaltig bewirtschafteten Wäldern nutzen und es nicht aus Ländern importieren, deren Waldwirtschaft wir nicht kontrollieren können.
Erstes Ziel der Nutzung heimischen Holzes ist und bleibt die stoffliche Nutzung – also das langfristige Festsetzen des Kohlenstoffs in Holzgebäuden, Holzkonstruktionen (z.B. Brücken) und in Gegenständen aus Holz. Von Buntstiften, über Schaufelstile bis hin zu Klavieren und Kontrabässen.
Wir können und wollen aber keine Baumarten züchten, die lediglich aus einem Stamm bestehen. Bäume werden immer auch Anteile haben, die nicht oder – im Falle von Schadholz – nicht mehr sägefähig sind oder die nicht die für eine sinnvolle stoffliche Nutzung erforderliche Qualität haben. Diese Anteile fallen bei jeder Holzernte ganz zwangsläufig mit an. Auf die Holzernte verzichten würde bedeuten, die Wälder dem natürlichen Gang des Irdischen zu überlassen. Jeder Baum würde dann irgendwann absterben. Da unsere Wälder keine Urwälder sind, sondern Kulturwälder mit einer mehrere Jahrhunderte lange Bewirtschaftungstradition, sind in einem Waldgebiet viele Bäume in etwa gleich alt und sterben ungefähr zur selben Zeit ab. Betrachten wir einen Wald als CO2-Speicher, dann kommt nach „voll“ irgendwann „tot“. Da wir die Holzproduktion im Wald nicht stoppen können, wird das immer so bleiben, obwohl der Waldumbau, hin zu einem höheren Laubholzanteil, den Zuwachs drosseln wird.
Wo sehen Sie die Grenzen nachhaltiger Holznutzung und welche Rolle spielt die energetische Verwertung im Vergleich zu stofflicher Nutzung, beispielsweise als Baustoff?
BK: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Potential unserer Wälder nutzen müssen, um die Dynamik des Klimawandels zu bremsen, ohne andere Alternativen wie das Wiedervernässen von Mooren zu vernachlässigen. Um dieses Potential aber – auch in unserer Verantwortung für nachfolgende Generationen – bestmöglich nutzen zu können, müssen wir dem Kohlenstoffspeicher Wald von Zeit zu Zeit Holz entnehmen, um dort Platz für zusätzliches CO2 zu schaffen, das die Wälder aus der Atmosphäre herausfiltern. Ist der Speicher randvoll, hilft er uns nicht mehr zusätzlich, bleibt im besten Falle bei seinem „maximalen Kohlenstoff-Füllstand“ stehen und kann im schlechteren Falle, nämlich dem gleichzeitigen Absterben vieler Bäume sogar zu einem Risiko – zu einem Netto-Emittenten von CO2 werden. Wir verstärken den Bremseffekt der Wälder auf den Klimawandel deshalb nur dann, wenn wir möglichst viel Holz zu langfristig nutzbaren Produkten weiterverarbeiten, so externe Speicher bilden und andere, deutlich energieaufwendigere, riskantere und klimaschädlichere Baustoffe und Materialien ersetzen. Nutzen wir nicht-sägefähige Holzsortimente und speziell dafür angebaute Hölzer zudem energetisch, verstärken wir diesen positiven Effekt zusätzlich.
Sollten wir aber in einem bestimmten Waldgebiet, in einem konkreten Waldbestand an einem ganz bestimmten Ort ein Ziel verfolgen, das wir – oder besser, das der Waldbesitzer oder die Waldbesitzerin – genau hier für wichtiger erachtet als die Bekämpfung des Klimawandels, dann hat dieses Ziel hier Vorrang. Das kann z.B. die Erholungsfunktion in Stadtnähe sein, der Schutz einer bestimmten Tier- oder Pflanzenart oder auch der Schutz unseres Grundwassers, der Erosionsschutz in den Bergen, der Lärmschutz oder anderes.
Die energetische Nutzung von Holz ist meines Erachtens weit mehr als eine Art Anhängsel oder Resteverwertung der stofflichen Nutzung. Neben ihrer bereits erwähnten geopolitischen Bedeutung, ihrer technischen Beherrschbarkeit und den Transportvorteilen gegenüber anderen Energieträgern – selbst gegenüber der Windenergie, denken Sie nur an die Debatten um und die Kosten der Südlink-Leitungen - vervollständigt sie die stoffliche Nutzung hinsichtlich ihrer Substitutionswirkung, trägt zur Deckung der Holzerntekosten bei und unterstützt so die Waldbesitzenden in ihrer Aufgabe den Wald zu erhalten und zukunftsfit zu machen.
Wie wichtig ist nachhaltige Forstwirtschaft für Deutschland? Wenn die energetische Nutzung wegfallen würde, bleibt nur die stoffliche Nutzung. Würde das ausreichen oder fiele damit eine große Einnahmequelle weg?
BK: Der erste Teil dieser zweiteiligen Frage ließe sich ganz einfach beantworten: Eine auch weiterhin gesichert nachhaltig und zukunftsorientierte Forstwirtschaft ist für Deutschland sehr wichtig. Hätten wir sie nicht mehr, würden wir die Verantwortung für die Sicherung und den Ausbau der globalen CO2-Speicher in den Wäldern und in den Holzprodukten sowie die Zusatzleistung durch die Substitution anderer, klimaschädlicher Baustoffe und Energieträger auf andere Länder delegieren und uns durch importiertes Holz aus der Verantwortung stehlen. Die heimische nachhaltige Forstwirtschaft ist deshalb aus den bereits genannten Gründen für uns alle sehr wichtig.
Die zweite Teilfrage grenzt diese grundsätzliche und globale Bedeutung jedoch zu sehr ein. Sie zielt ausschließlich auf Geldwerte, auf Umsatz und Einkommen. Also auf betriebswirtschaftliche Größen, deren Grundlage Preise und damit der erfolgreiche Verkauf von Gütern und Dienstleistungen aus dem Wald sind. Diese Bedeutung der Wälder hat in den vergangenen Jahrzehnten stetig abgenommen. So gibt es z.B. kaum noch Kommunen, die auf die Einnahmen aus ihrem Kommunalwald wirklich angewiesen sind. Anders stellt sich das für Teile des privaten Waldbesitzes und für die innovative, leistungsstarke und moderne Holzwirtschaft in Deutschland dar. Allerdings nicht wegen der Einnahmen, sondern wegen der qualitativ vertrauenswürdigen und quantitativ verlässlichen Versorgung der Produktion mit geeignetem Holz. Für den Waldbesitz und die Holzwirtschaft sind die Einnahmen aus der thermischen Verwertung der sogenannten Restholzsortimente ein willkommenes, aber für die meisten nicht „überlebenswichtiges Zubrot“.
Beim Erhalt und der Stärkung der heimischen Forstwirtschaft geht es aber nicht alleine um die Einkommensfunktion der Wälder, sondern es geht um die Sicherung zahlreicher anderer, zusätzlicher Werte und Leistungen, die für uns alle von großer Bedeutung sind, für deren Konsum und Inanspruchnahme wir aber in der Regel nichts bezahlen müssen. Sie haben keinen Preis. Teilweise wird der Erhalt solcher Schutzleistungen und der Erholungsfunktion des Waldes staatlich unterstützt. Aus Sicht der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer müssen sie jedoch ganz überwiegend aus den Einkommen der Nutzfunktion ihres Waldes mitbezahlt werden. Angesichts des kostspieligen und dringenden Waldumbaus zählt jeder Euro – auch und ausdrücklich jeder Euro, der unter den Bedingungen einer verantwortlichen und nachhaltigen Forstwirtschaft für Energieholzsortimente eingenommen werden kann.
Welchen Beitrag kann die Kaminbranche leisten, um den Wald zu schützen und gleichzeitig als Ressource verantwortungsvoll zu nutzen?
BK: Obwohl Wälder als CO2-Senken, anders als Moore und die Weltmeere, von uns Menschen vermehrt und vergrößert werden können und das Holz unablässig nachwächst, ist und bleibt das Multitalent Holz eine knappe Ressource. Sie ist zugleich ein Opfer des Klimawandels und einer unserer möglichen „Retter“. Um die Wälder nicht zu überfordern müssen gerade wir in unserer wohlhabenden, technisch hoch entwickelten Volkswirtschaft sehr darauf achten, mit dieser knappen Ressource verantwortlich umzugehen.
Auch die Kaminbranche darf deshalb in ihrem Bemühen nicht nachlassen, die thermische Nutzung von Holz möglichst effizient und möglichst emissionsarm zu machen. Das „stufenlos über die Balkontür zu regelnde Wohlfühlfeuer im offenen Kamin“ gehört deshalb zurecht der Vergangenheit an. Das weiß die Branche längst und bietet hochmoderne Heizsysteme an, die eben nicht gestrig sind, sondern ein innovativer und sicherer Teil unserer Wärmewende.
Ich würde mir deshalb eine modernere und offensivere Selbstdarstellung und Werbung der Branche wünschen. Bilder, die die Lagerfeuerromantik der Kundinnen und Kunden ansprechen, müssen endlich aus der Werbung verschwinden. Andererseits könnte man durchaus offensiver damit umgehen, dass auch das Verbrennen des Holzes nicht emissionsfrei möglich ist, dass diese Emissionen gut geführter, moderner Anlagen aber nicht höher sind als die moderner Gasheizungen.
Und die Holzverbrennung ist im Unterschied zu den fossilen Alternativen klimaneutral. Es macht für unser Bemühen den Klimawandel zu bremsen sehr wohl einen Unterschied, ob wir beim Verbrennen fossiler Brennstoffe (Öl, Kohle, Gas) Klimagase freisetzen, die der Atmosphäre Jahrmillionen entzogen waren oder ob es sich um das CO2 handelt, das „erst kürzlich“ noch Gas, nur vergleichsweise kurz als Holz gebunden und der Atmosphäre entzogen war. Hinzu kommt, dass das bei der Holzverbrennung zur Wärme- und/oder Energiegewinnung freigesetzte Gas nie mehr sein kann als das, was auch bei natürlichen Vermoderungsprozessen oberirdisch freigesetzt werden würde. Dann allerdings ohne zuvor irgendeinen energetischen Nutzen aus dem Holz gezogen zu haben.
Wenn wir uns zudem bewusst machen, dass wir angesichts der drängenden Zeit und der Dynamik des Klimawandels aktuell sogar gezwungen sind, das CO2, das wir mit Öl, Gas oder Kohle aus seinen tiefen, uralten Erdspeichern hervorgeholt haben, ein paar Hundert Kilometer weiter, mit hohem finanziellen und energetischen Aufwand, wieder in tiefen Erdschichten zu vergraben (CCS-Technologie), dann werden uns die Absurdität der fossilen Brennstoffe, ihrer Emissionen und die Vorteile der thermischen Nutzung von Holz noch deutlicher.
Wie müsste sich der Wald in den kommenden zehn Jahren entwickeln, damit er sowohl den Herausforderungen des Klimawandels standhält als auch eine nachhaltige Holzversorgung sichergestellt ist?
BK: Die gute Nachricht vorweg: Es wird in unseren Breiten noch sehr lange Wälder geben. Trotz des Klimawandels. Diese Wälder werden aber anders sein als unsere Wälder heute und in ihnen werden andere Baumarten wachsen. Würden wir unsere Wälder, die wir seit über 300 Jahren bewirtschaften und nutzen, sich selbst überlassen und hoffen, dass sie sich selbst an das zukünftige Klima anpassen, dann würden wir für viele Jahrzehnte großflächige Katastrophen, bis hin zum zeitweisen kompletten Absterben unserer Wälder in Kauf nehmen. Aus unseren „Kulturwäldern“ werden nicht einfach Natur- oder gar Urwälder. Die Dynamik des Klimawandels ist inzwischen viel höher als die Selbstanpassungskräfte der „Natur“ darauf reagieren können.
Die Zeit drängt. Und, wie ich schon sagte, geht es bei der Holznutzung nicht nur um den Einsatz eines schönen, modernen und nachwachsenden Rohstoffs und die Nutzung einer politisch wie technisch risikolosen Energie, sondern auch darum, der Atmosphäre möglichst viel CO2 zu entziehen, im Wald (Waldspeicher) und in Holzprodukten (externer Speicher) langfristig zu binden sowie möglichst viele klimaschädliche Baustoffe, Materialien und Energieträger zu ersetzen (Substitution). Es geht also nicht um ein „Nice to have“, sondern um ein „Must have“!
Weil die kommenden 20 bis 30 Jahre ganz entscheidend sein werden, müssen wir die Wälder weiter aktiv umbauen, das Risiko auf viele Baumarten verteilen, mehr auf Laubbäume setzen als auf Nadelbäume und dennoch darauf achten, dass unsere Wälder auch in Zukunft stofflich und energetisch verwertbares Holz produzieren.
Vielleicht können wir deshalb nicht mehr an dem Anspruch festhalten, dass jeder Hektar Wald fast alles kann: Holz produzieren, Erholungsräume schaffen und zahlreiche Schutzwirkungen entfalten. Das mag sein. Dann sollten wir erwägen und versuchen, den Waldumbau hin zu einem höheren Anteil klimaresilienter Laubbaumarten sowie die Schutz- und Erholungsleistungen auf möglichst großer Fläche durch die Nutzung sägetechnisch gut verwertbarer Baumarten, mit einem vergleichsweise schnellen Wachstum auf kleineren Flächen zu finanzieren und damit zugleich den Ausbau der externen CO2-Speicher der Wälder und ihre Substitutionswirkung weiter zu forcieren.
Wir danken Prof. Dr. Dr. h.c. Bastian Kaiser herzlich für das ausführliche Gespräch. Die Aussagen machen deutlich: Holz ist kein romantisches Relikt. Es ist ein zentraler Baustein für eine nachhaltige Wärmeversorgung. Vorausgesetzt, seine Nutzung erfolgt verantwortungsvoll und im Gleichgewicht mit der ökologischen Realität. Die Kaminbranche ist hier ebenso gefragt wie Politik und Forstwirtschaft.
Prof. Dr. Dr. h.c. Bastian Kaiser
Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
Professur für Angewandte Betriebswirtschaft,
Internationale Entwicklungszusammenarbeit

Bin im Wald!
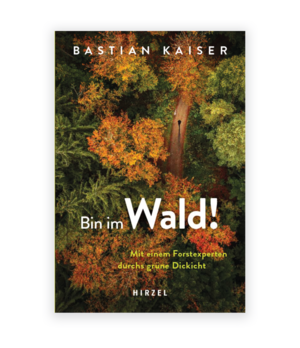
2022 veröffentlichte Bastian Kaiser im Hirzel-Verlag Stuttgart sein Buch „Bin im Wald!“. Darin versucht er den Wald, die Waldwirtschaft und deren Zusammenhänge mit dem Klima-, dem Natur- und dem Artenschutz, mit der Holzwirtschaft und unserer Kultur so zu „erzählen“, dass sich eine breite Leserschaft davon unterhalten und zugleich informieren lassen kann. Die ersten beiden Auflagen waren innerhalb eines Kalenderjahres ausverkauft. Inzwischen ist die dritte Auflage des Buches erhältlich, erstmals mit einem Vorwort von Prof. Hans Joachim Schellnhuber, dem Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
